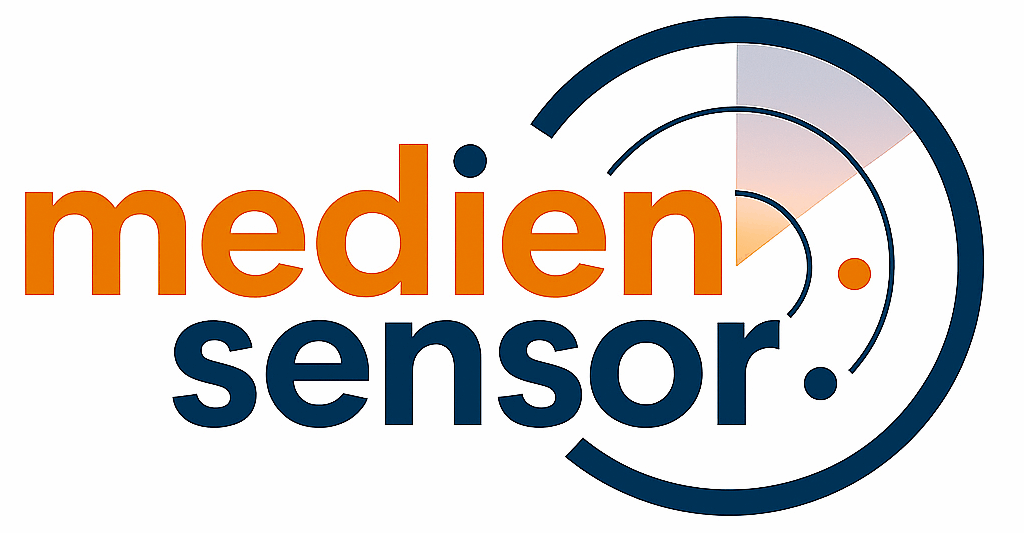Noch vor gut einem Jahrzehnt war der Begriff „Influencer*in“ eine Randerscheinung. Menschen, die auf Plattformen wie YouTube, Instagram oder später TikTok regelmäßig Inhalte teilten, taten dies meist aus Spaß oder aus Leidenschaft für ein bestimmtes Thema: Mode, Gaming, Musik oder Reisen. Reichweite bedeutete damals vor allem Anerkennung in einer Nische, nicht unbedingt ein Geschäftsmodell.
Heute hat sich diese Szene zu einem globalen Wirtschaftszweig mit Milliardenumsätzen entwickelt. Laut einer Studie von Statista (2023) wird der weltweite Markt für Influencer*innen-Marketing auf über 21 Milliarden Euro geschätzt – Tendenz steigend. Unternehmen investieren gezielt in Kooperationen mit Influencer*innen, weil deren Nähe zum Publikum gut ankommt und als authentisch empfunden wird.
Diese besondere Form der „parasozialen Beziehung“ – einseitig, aber emotional – gilt als Schlüssel zum Erfolg: Follower*innen vertrauen Empfehlungen oft mehr als klassischer Werbung (Bundeszentrale für politische Bildung 2022). Darüber hinaus spielen Influencer*innen auch im Bereich Lebensstil, Trends, Bildung und Wissenschaft eine immer bedeutendere Rolle.
Wenn Meinung und Marketing verschwimmen
Das Geschäftsmodell ist einfach, aber hochwirksam: Influencer*innen präsentieren Produkte, Dienstleistungen, Marken oder Botschaften in einem scheinbar privaten Kontext – beim Frühstück, im Fitnessstudio, auf Reisen. Die Inszenierung lässt den Eindruck entstehen, das Produkt sei ein natürlicher Teil ihres Lebens, auch wenn in Wirklichkeit häufig ein klar geregelter Vertrag dahintersteckt.
In Deutschland gilt die gesetzliche Pflicht zur Werbekennzeichnung (§ 5a Abs. 6 UWG). Beiträge müssen eindeutig als „Anzeige“ oder „Werbung“ gekennzeichnet sein, sobald dafür eine Gegenleistung geflossen ist. Die Realität sieht oft anders aus: Manche Influencer*innen setzen den Hinweis so klein, dass er leicht übersehen wird, andere platzieren englische Kürzel wie „ad“ oder „spon“ an Stellen, die viele Follower*innen gar nicht beachten.
In mehreren Urteilen – etwa dem Fall „Vreni Frost“ vor dem Kammergericht Berlin (2019) – wurde deutlich, dass fehlende oder unklare Kennzeichnungen als wettbewerbswidrig gelten können. Kritische Stimmen sprechen längst von einer „Verwischung der Grenzen“ zwischen privater Meinung und kommerzieller Botschaft (Verbraucherzentrale 2023).
Jugendkultur im digitalen Wandel
Die Rolle von Influencer*innen geht mittlerweile weit über Produktwerbung hinaus: Sie sind zu zentralen Akteur*innen der Jugendkultur geworden. Wo Meinungen, Stile und Trends früher vor allem in Clubs, auf der Straße oder in Subkulturen entstanden, genügen heute wenige virale Videos oder Bilder, um bestimmte Debatten anzustoßen oder Modefarben, Musikrichtungen und Slang-Ausdrücke weltweit zu verbreiten.
Diese digitale Dynamik eröffnet Chancen, birgt jedoch auch viele Risiken und geht mit problematischen Entwicklungen einher: Einerseits ermöglicht diese neuartige Form des Trendsettings jungen Menschen, kulturelle Vielfalt zu erleben, neue Ideen zu entdecken und selbst kreativ zu werden. Andererseits entsteht durch Influencer-Marketing ein permanenter Erlebnisdruck und Drang zur Selbstinszenierung: Wer dazugehören will, muss nicht nur ständig konsumieren und Besonderes erleben, sondern auch fast rund um die Uhr posten, liken, reagieren – und sein Leben möglichst „perfekt“ in Szene setzen.
Erlebnisdruck und Selbstinszenierung
Der Einfluss von Influencer*innen wird immer größer und reicht tief in das Selbstbild junger Menschen hinein. Sichtbarkeit wird in Social Media durch Likes, Kommentare und Followerzahlen messbar. Diese Metriken können motivieren – aber auch erheblichen Druck erzeugen. Der so genannte „Erlebnisdruck“ – etwa das Gefühl, ständig spannende, fototaugliche Momente präsentieren zu müssen (in der Online-Sprache ist auch von FOMO für „Fear of Missing Out“ die Rede) – verstärkt sich durch den Vergleich mit makellos inszenierten Vorbildern.
Viele Influencer*innen setzen Schönheits- und Lifestyle-Standards, die nur mit Filtern, Bildbearbeitung oder professioneller Produktion erreichbar sind. Studien wie die JIM-Studie (2023) zeigen, dass dies zu erhöhtem Stress, sinkendem Selbstwertgefühl und ungesunden Vergleichen führen kann. Doch das Problem ist nicht nur, dass Influencer-Marketing unrealistische Maßstäbe setzt. Es verschiebt auch die Prioritäten: Die Frage, wie etwas wirklich ist oder sich anfühlt, wird immer deutlicher von der Außensicht verdrängt. Dies birgt die Gefahr, dass das eigene Leben zunehmend als „Rohmaterial“ für präsentablen Content wahrgenommen wird, statt als echte gelebte Erfahrung.
Style over Substance – Der neue Zeitgeist?
Die Welt der Influencer*innen ist geprägt von der Idee, dass jeder Augenblick potenziell geteilt, kommentiert und bewertet werden kann. Doch wer sein Leben permanent in Szene setzt und scheinbar besondere oder einzigartige Momente stets mit der Masse teilt, läuft Gefahr, den Augenblick nicht mehr für sich zu erleben. Psycholog*innen warnen davor, dass diese ständige Außengerichtetheit – der Blick darauf, wie eine Situation von anderen wahrgenommen wird – wichtige Fähigkeiten wie Achtsamkeit untergräbt.
An die Stelle des unmittelbaren Erlebens tritt eine Art „Dauer-Inszenierungsmodus“, in dem jedes Lachen, jedes Essen, jede Reise in Kategorien von Fotogenität, Reichweite und Likes gedacht wird. Philosophisch betrachtet verlagert sich der Wert des Moments von seinem inneren Gehalt – der Freude, der Erkenntnis, dem Erleben – hin zu seiner öffentlichen Wirkung. Das von dem US-amerikanischen Soziologen Erving Goffman bereits in den 1950er-Jahren beschriebene „Leben als Bühne“ beschreibt eine Metapher für außengeleitete Selbstdarstellung, die mit Social Media regelrecht zur wörtlichen Realität geworden ist.
Jungen Menschen wird rund um die Uhr von Trendbotschafter*innen vorgelebt, dass Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit mehr zählen als inhaltliche Tiefe. Wer im digitalen Raum Erfolg haben will, muss Trends folgen, Emotionen optimieren und Ästhetik perfektionieren – in der Regel auf Kosten von Authentizität und Komplexität. Langfristig formt dies eine Mentalität, in der Oberflächlichkeit belohnt wird, während echte Substanz – wie Achtsamkeit, Tiefgang und charakterliche Qualitäten – weniger sichtbar und damit weniger erstrebenswert erscheint. Für eine Generation, die in dieser Logik aufwächst, besteht die Herausforderung zunehmend darin, innere Werte und stille, nicht inszenierte Momente als bedeutungsvoll zu begreifen.
Vorbilder oder Verkaufsprofis?
Für viele Jugendliche sind Influencer*innen mittlerweile entscheidende Identifikationsfiguren, die junge Menschen einst vor allem in Musikidolen oder Schauspieler*innen gesehen haben. Einige Online-Stars nutzen ihre Reichweite auch für soziale Anliegen, setzen sich für Umweltthemen, Nachhaltigkeit, Diversität oder gesellschaftliche Debatten ein. Andere fokussieren sich fast ausschließlich auf Produktplatzierungen und kommerzielle Kooperationen.
Diese Mischung erschwert es Follower*innen, zwischen authentischen Meinungen und bezahlten Werbeposts zu unterscheiden. Besonders problematisch ist Schleichwerbung, bei der Kooperationen bewusst nicht transparent gemacht werden. Hier stoßen rechtliche Vorgaben schnell an ihre Grenzen – und Medienkompetenz wird zu einem entscheidenden Schutzmechanismus.
Auswirkungen auf Gesellschaft und Konsum
Influencer*innen-Marketing verändert nicht nur individuelle Kaufentscheidungen, sondern auch die Werbelandschaft. Klassische Medien verlieren Anteile an Budgets, während einzelne Social-Media-Accounts Millionenverträge abschließen. Die Macht, welche Inhalte sichtbar werden, verschiebt sich damit in Richtung Einzelpersonen, die teils ohne redaktionelle Kontrolle Trends setzen und Debatten beeinflussen.
Gesellschaftlich führt dies zu einer neuen Art Gatekeeper-Funktion. Immer häufiger entscheiden Influencer*innen, welche Produkte, Themen und Narrative Beachtung finden – und welche nicht. In einer Zeit, in der für viele Jugendliche digitale Plattformen nicht nur die wichtigste Informationsquelle darstellen, sondern auch der Freizeitbeschäftigung, Unterhaltung und Kommunikation dienen, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf Meinungsbildung, gesellschaftliche Vielfalt und demokratische Prozesse haben (Klicksafe 2023).
Der Trend zu Wissenschafts-Influencer*innen
Ein neues Phänomen sind so genannte Wissenschafts-Influencer*innen. Immer mehr Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen setzen auf sie, um komplexe Inhalte für ein breiteres – insbesondere jüngeres – Publikum zugänglich zu machen. Beispiele sind Physiker*innen, die auf TikTok Experimente erklären, Mediziner*innen, die auf Instagram Gesundheitsmythen aufklären oder Historiker*innen, die auf YouTube Geschichte in Kurzvideos vermitteln. Chancen und Nutzen liegen auf der Hand: Wissenschaft wird durch persönliche Ansprache nahbarer, abstrakte Inhalte werden anschaulich und können auch Menschen erreichen, die sich sonst nicht damit beschäftigt hätten. Storytelling-Elemente werden auch im Bildungsbereich erfolgreich eingesetzt, um komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen und Barrieren abzubauen.
Doch es gibt auch Risiken und Bedenken: Die Logik der sozialen Medien – kurze Aufmerksamkeitsspannen, zugespitzte Botschaften, emotionale Hooks – steht mitunter im Widerspruch zu wissenschaftlichen Prinzipien wie Sorgfalt, Seriosität und Objektivität. Um Reichweite zu erzielen, werden Inhalte vereinfacht oder emotional zugespitzt. Kritische Stimmen warnen davor, dass dies zu einer „TikTokisierung“ der Wissenschaft führen könne: mehr Affektsteuerung und Vereinfachung, weniger Differenzierung.
Dies geht mit berechtigten Fragen einher: Fördert dieser Trend langfristig Bildung und Wissenschaftsnähe – oder unterwirft er die Wissenschaft zunehmend den Mechanismen eines solchen Marketings, bei dem Aufmerksamkeit und Klickzahlen wichtiger sind als Inhalt, Präzision und Unabhängigkeit? Kann Wissenschaft überhaupt unabhängig und objektiv bleiben, wenn sie von Trend- und Meinungsbotschafter*innen repräsentiert wird? Die Antwort hängt stark von der Integrität der Akteur*innen ab – und von der Fähigkeit des Publikums, diese kritisch zu hinterfragen. Auch die Politik ist hier in der Pflicht, durch klare Strukturen und Regeln Transparenz und wissenschaftliche Autonomie zu gewährleisten. Zudem ist es immer entscheidender, durch gezielte Bildungs- und Aufklärungsangebote ein kritisches Bewusstsein für die wichtigen Themen der Digitalisierung zu stärken.
Zwischen Inspiration und Manipulation
Die Debatte über strengere Gesetze, klarere Kennzeichnungen und unabhängige Kontrollen ist wichtig. Aber diese allein werden nicht ausreichen. Entscheidend ist, dass Nutzer*innen die Strukturen, Interessen und Mechanismen der Plattformen kennen. Medienkompetenz bedeutet heute, neben technischen Fähigkeiten auch psychologische, wirtschaftliche und rechtliche Hintergründe zu verstehen. Darüber hinaus spielt digitale Resilienz eine immer wichtigere Rolle in unserer vernetzten „Always-On“-Gesellschaft: die Fähigkeit, Herausforderungen und Risiken der digitalen Welt zu bewältigen, sich von negativen Erfahrungen zu erholen und sich vor medialen Stressfaktoren ausreichend zu schützen.
Influencer*innen sind heute ein fester Bestandteil der Medienlandschaft. Sie können informieren und inspirieren, Menschen verbinden und neue Horizonte öffnen. Gleichzeitig sind sie Teil eines Systems, das vielfach oberflächliche Styles über Inhalte stellt, oft fragwürdige Ideale prägt und schnelllebige Aufmerksamkeit in Umsatz verwandelt – auch unter Einsatz ausgefeilter psychologischer Strategien. Ob ihr Einfluss bereichernd oder problematisch wirkt, hängt nicht allein von ihnen selbst ab, sondern auch von den gesellschaftlichen Strukturen und der kritischen Distanz des Publikums.
In einer Gesellschaft, in der jede*r mit dem Smartphone zum Sender werden kann, wird eine Fähigkeit zunehmend wichtiger: hinter die Kulissen zu blicken und bewusste Entscheidungen zu treffen – über das, was wir konsumieren, glauben und weiterverbreiten ebenso wie das, was wir besser nicht glauben und auf welches wir lieber verzichten möchten.
Im Text genannte und ausgewählte Quellen:
- Bundeszentrale für politische Bildung (2022): Influencer*innen: Zwischen Authentizität und Kommerz.
- Kammergericht Berlin (2019): Urteil im Fall „Vreni Frost“ – Werbekennzeichnungspflichten für Influencer*innen.
- Verbraucherzentrale Bundesverband (2023): Werbekennzeichnung bei Influencer*innen.
- JIM-Studie (2023): Jugend, Information, Medien. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Klicksafe (2023): Influencerinnen-Marketing & Werbung in Social Media.
- Statista (2023): Marktvolumen Influencer*innen-Marketing weltweit*.