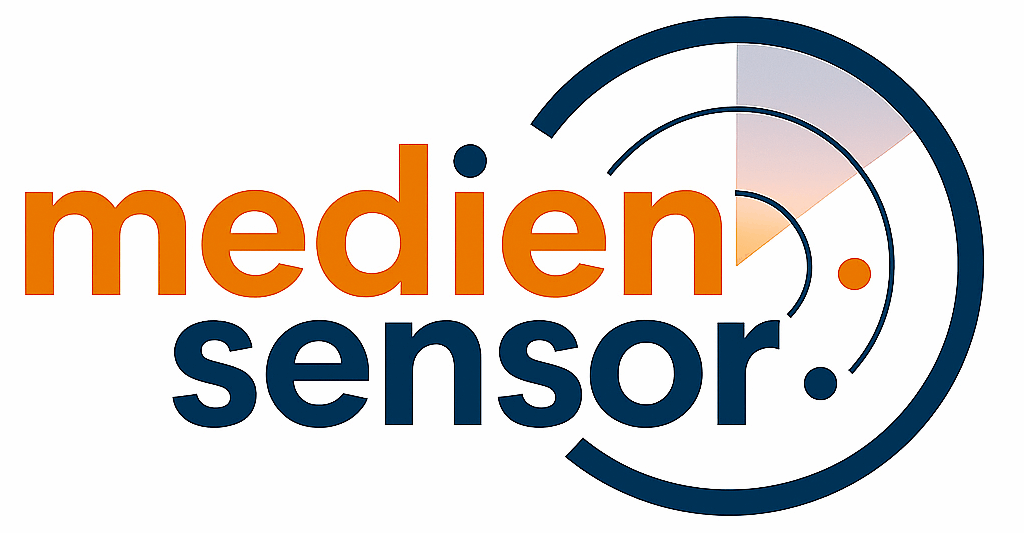Frauke Brosius-Gersdorf, Staatsrechtlerin und Professorin für öffentliches Recht, war als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht im Gespräch. Doch ihre mögliche Berufung wurde zunächst gestoppt. Ihre Nominierung durch SPD und Grüne stieß auf heftigen Widerstand, insbesondere aus Reihen der Union und aus der politischen Rechten. Als Begründung wurden unter anderem ihre Positionen zur Corona-Impfpflicht und zum Schwangerschaftsabbruch genannt. Schnell stand der Vorwurf im Raum, die Juristin habe mit autoritären Gedankenspielen operiert, Menschenrechte relativiert und mitgeholfen, eine gesellschaftliche Spaltung zu vertiefen.
Während vor allem konservative und rechte Kreise von einer „ideologischen Kandidatin“ sprachen, warnten andere vor einer „politischen Kampagne gegen eine wissenschaftlich hochqualifizierte Frau“ (Welt 2024). Brosius-Gersdorf selbst beklagte eine „unsachliche, intransparente und diffamierende“ Debatte, bei der nicht ihre juristische Kompetenz, sondern politische Zuschreibungen den Ausschlag gegeben hätten (FAZ 2024). Was folgte, war eine hitzige Debatte: Ist sie Opfer einer „cancelnden“ Empörungskultur geworden? Oder war die Kritik an ihren Aussagen legitim, u.a. weil sie sich früh klar für eine Impfpflicht positionierte, obwohl wissenschaftlich und ethisch vieles ungewiss war? Die Wirklichkeit verlangt eine genauere Analyse.
Corona-Rückblende: Ein Gutachten und seine Folgen
In einem juristischen Gutachten von 2021, das sie mit ihrem Mann verfasste, befürwortete Brosius-Gersdorf eine allgemeine Impfpflicht und schlug vor, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, finanziell an Folgekosten zu beteiligen (Brosius-Gersdorf & Gersdorf 2021). Diese Position wurde von Teilen der Fachöffentlichkeit als juristisch tragfähig, politisch und gesellschaftlich jedoch als hoch umstritten eingestuft. Kritiker werfen ihr vor, dabei normative Grenzüberschreitungen in der Abwägung von Grundrechten vorgenommen zu haben – insbesondere unter Berücksichtigung der damals bekannten Datenlage zur Wirkung der Covid-19-Impfstoffe.
Denn zum Zeitpunkt des Gutachtens war bereits bekannt, dass die Impfstoffe keine sterile Immunität erzeugen (wie zunächst behauptet) und somit nicht vor Ansteckung schützten. Auch war unstrittig, dass es sich um Vakzine mit bedingter Zulassung handelte, bei denen Langzeitdaten fehlten. Brosius-Gersdorfs Haltung zu diesem sehr relevanten, sensiblen Thema (Eingriffe am menschlichen Körper) wirkt vor diesem Hintergrund nicht angemessen und differenziert, sondern fragwürdig und normativ zugespitzt.
Zudem zeigte sich bereits frühzeitig, dass die Wirksamkeit gegen Infektion mit jeder Virusvariante nachließ. Dennoch wurde in Politik und Medien weiterhin mit dem Schutz der Allgemeinheit argumentiert – ein Narrativ, das kritische Stimmen nicht nur zunehmend als ideologisch einengend und bevormundend empfanden, sondern das in Anbetracht der Faktenlage auch an Angemessenheit und wissenschaftlicher Evidenz mangeln ließ.
Umstrittene Haltung zu Abtreibung und AfD-Parteiverbot
Die zweite große Kontroverse entzündete sich an Brosius-Gersdorfs Haltung zur Reform des §218 StGB, bei der sie sich für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bis zur 12. Woche aussprach. Der Vorwurf, sie wolle Abtreibungen bis zur Geburt erlauben, wurde insbesondere in konservativen und rechten Netzwerken verbreitet, stellte sich jedoch als unwahr heraus. Brosius-Gersdorf wies diese Vorwürfe gegen sie öffentlich entschieden zurück (etwa Spiegel 2024, Markus Lanz/ ZDF 2024).
Darüber hinaus sorgte Frauke Brosius-Gersdorfs Haltung zu einem möglichen AfD-Parteiverbot für hitzige Debatten. Befürworter sahen in ihrer Position, ein Verbot sei bei hinreichend belegtem verfassungswidrigen Verhalten gerechtfertigt, ein Zeichen für eine wehrhafte Demokratie. Kritiker warfen ihr hingegen vor, sich parteipolitisch zu positionieren und warnten vor einem „ideologisch gesteuerten Justizapparat“. Zugleich entzündete sich eine breitere Debatte an der Frage, wie sinnvoll und demokratisch ein Parteiverbot überhaupt wäre.
Kritische Stimmen aus unterschiedlichen politischen Lagern warnten, ein Verbot der AfD wirke wie ein autoritärer Eingriff in den Wählerwillen – schließlich handle es sich um eine demokratisch gewählte Partei, die mittlerweile zweistellige Ergebnisse erzielt und in mehreren Landesparlamenten sowie im Bundestag stark vertreten ist. Ein solcher Schritt würde den gesellschaftlichen Riss noch vertiefen, die Vorwürfe von Zensur und Ausgrenzung befeuern und extremen Positionen eine neue Legitimation verschaffen.
Verleumdungskampagne oder berechtigte Kritik?
Anders als bei reinen Online-Shitstorms geht es hier nicht bloß um verzerrende und rufschädigende Falschbehauptungen, sondern auch um zentrale Debatten über ein hohes Staatsamt – um die Frage der Integrität und juristischen Sensibilität in krisenhaften Zeiten. Die Kritik an der Kandidatin wurde zudem nicht nur aus politisch rechten Kreisen laut, sondern kam auch aus dem konservativen, liberalen, medizinischen und rechtswissenschaftlichen Milieu, das eine Überprüfung von Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz einforderte.
Kritik an den Positionen der Juristin wurde von einigen Seiten jedoch sofort als „rechtspopulistische Instrumentalisierung“ angeprangert, da die AfD den Fall schon früh aufgegriffen und aufgeladen habe. Die Darstellung, Brosius-Gersdorf habe Abtreibungen bis kurz vor der Geburt legalisieren wollen, stellte sich als eine gezielte Verzerrung ihrer tatsächlichen Haltung heraus. Doch aus dieser Erkenntnis wurde rasch eine Pauschalverurteilung anderer kritischer Stimmen.
Die Mechanik ist bekannt: Wer Kritik äußert, gilt schnell als ideologisch motiviert. Wer differenziert, wird in vielen Fällen marginalisiert oder ignoriert. Dabei ist die Kritik an Brosius-Gersdorfs juristischer Positionierung keineswegs schlicht als „Kulturkampf von rechts“ einzustufen. Die aktuelle Debatte greift demokratisch zentrale Fragen auf – etwa: Sollte jemand, der mit staatlicher Gewalt Eingriffe in den Körper unter Verhältnissen rechtfertigt, die wissenschaftlich und ethisch unsicher waren, in das höchste Gericht der Republik einziehen?
Wenn Abwehr zur moralischen Waffe wird
Zahlreiche kritische Stimmen kamen aus der Zivilgesellschaft, etwa von Medizinern, Verfassungsrechtlern, Journalisten oder Betroffenen selbst – ohne eine erkennbare politische Radikalisierung. Sie fühlten sich jedoch medial schnell in die „rechte Ecke“ gestellt, was eine differenzierte Diskussion erschwerte. Gerade in dieser Dynamik liegt ein ernst zu nehmendes Problem: Es geht nicht schlicht um Fragen nach einer medialen Verleumdungskampagne oder einem Shitstorm, sondern auch um solche nach einer neuen Form strategischer Diskurskontrolle: Wer sich einer kritischen Haltung gegenüber bestimmten politischen Entscheidungen bedient, wird nicht argumentativ widerlegt, sondern durch Einordnung in ein negativ konnotiertes ideologisches Lager delegitimiert.
Diese Logik der Entwertung betrifft dann längst nicht nur „populistische Stimmen“, sondern ebenso reflektierte und argumentativ fundierte Kritik. Der Vorwurf, die neue Rechte nutze „Cancel Culture“ lediglich als Kampfbegriff, wird dabei selbst zur rhetorischen Waffe: Er enthebt die eigene Seite jeder inhaltlichen Auseinandersetzung, stempelt Kritik pauschal ab und stigmatisiert kritische Stimmen als ideologisch motiviert oder gar verblendet.
Selbst wenn scharfe Kritik an Brosius-Gersdorf insbesondere aus dem rechtskonservativen Lager kam, kann und darf die berechtigte Kritik an autoritären Tendenzen während der Corona-Politik keinesfalls schlicht als ideologische Vereinnahmung (hier „von rechts“) abgetan werden. Kritiker bemängeln in diesem Zusammenhang nicht nur ein „Moralisieren von links“, sondern insbesondere das Diskreditieren von abweichenden Stimmen, das letztlich zur Verengung des demokratischen Diskurses führe. Die Antwort darauf darf nicht reflexhaft erfolgen – es geht um nicht weniger als das Vertrauen in wichtige Institutionen, um Diskursfähigkeit und Fehlerkultur. Und auch um die Frage, was man aus Pandemie-Politik zu lernen bereit ist.
Corona und das verdrängte Unbehagen
Die Corona-Krise hat nicht nur ein Virus verbreitet, sondern auch eine neue Kommunikationslogik etabliert: schnelle Urteile, moralische Lagerbildung, hohe Emotionalität. Die Plattformisierung der Debatten, verstärkt durch algorithmische Dynamiken, hat dazu geführt, dass komplexe Zusammenhänge auf Schlagworte reduziert wurden. Die Tendenz in den klassischen Medien war dabei bemerkenswert: Die Mehrheit der öffentlichen Leitmedien übernahm weitgehend eine regierungsnahe Perspektive. Kritische und oppositionelle Stimmen zur Corona-Politik – selbst von renommierten Wissenschaftlern wie John Ioannidis oder Klaus Stöhr – erfuhren in den Leitmedien oft eine klare Deutung als abweichend, problematisch oder falsch. Kritische Sichtweisen wurden zu großen Teilen marginalisiert und teils auch diskreditiert.
Auch innerhalb der Wissenschaft dominierte lange Zeit ein Konsens-Narrativ, das abweichende Positionen als „unsolidarisch“, „verantwortungslos“ oder „unwissenschaftlich“ etikettierte. Dabei lebt gerade die Wissenschaft vom Dissens, vom methodischen Zweifel, vom Einbeziehen unterschiedlicher Hypothesen. Die systematische Marginalisierung kritischer Stimmen führte zu einer Vertrauenskrise, deren Nachwirkungen sich bis heute zeigen. Die Polarisierung wurde nicht nur durch Populismus, sondern auch durch mediale Vereinfachung und moralische Aufladung befeuert.
Dass und wie Brosius-Gersdorf in der Kritik steht, ist auch Ausdruck dieses kollektiven Unbehagens – eines Gefühls, dass zu viele Fragen zu schnell beantwortet, zu viele Positionen zu rasch festgelegt und zu viele Meinungen vorschnell aussortiert wurden. Insbesondere nachdem sich zentrale medial verbreitete Versprechen oder Aussagen von Wissenschaft und Politik im Rückblick als nicht zuverlässig oder sogar falsch erwiesen hatten (etwa zu Wirkung und Nebenwirkungen der Corona-Impfung), wuchsen Enttäuschung und Misstrauen innerhalb der Gesellschaft und die Forderung nach einer Aufarbeitung der politischen Corona-Maßnahmen wurde lauter.
Was die Debatte über uns sagt
Es ist berechtigt, gesellschaftlich relevante Fragen zu stellen: Was heißt Verantwortung im Rückblick? Wie gehen wir mit jenen um, die damals Positionen vertraten, die heute als übergriffig, autoritär oder unverhältnismäßig gelten? Und wie vermeiden wir, dass berechtigte Kritik in diskursive Ausschlüsse umschlägt? Der Fall Brosius-Gersdorf zeigt auf verschiedenen Ebenen exemplarisch, wie leicht Narrative über Fakten siegen und die inhaltliche Diskussion überlagern können.
Wer differenziert kritisieren will, muss sich davon emanzipieren. Und wer vor Cancel Culture warnt, darf nicht jede Kritik als Empörung diffamieren. Mehr noch: Gerade die politische Linke, die immer wieder den Pluralismus hochhält, muss sich hier fragen lassen, ob sie nicht selbst zur Vereinfachung beiträgt, wenn sie bei unbequemen Fragen zur Pandemiegeschichte das Polarisieren und Moralisieren übernimmt, das sie an anderer Stelle bei der Rechten anprangert. Denn die Frage, wer das Verfassungsgericht repräsentiert, ist keine Nebensache. Sie betrifft das Herz unserer Demokratie und verdient eine Debatte, die mehr will als Zuschreibungen und Zurechtweisungen.
Cancel Culture: Kampfbegriff oder Symptom?
„Cancel Culture“ – das Schlagwort ist längst zum politischen Reizwort geworden, emotional aufgeladen und in seiner Bedeutung umkämpft. Gerne wird es pauschal verwendet, um sich als Opfer einer moralisch übergriffigen Gegenstimme zu stilisieren. Von der Gegenseite wird der Begriff hingegen allzu häufig als rhetorisches Nebelgeschoss abgestempelt, um (möglicherweise) berechtigte Kritik zu verschleiern oder abzuwehren. Beides kann zutreffen – und beides verfehlt dann den Kern, wenn man den Begriff ausschließlich als Waffe und nicht als Warnsignal versteht, ohne Bereitschaft, sich inhaltlich mit kritischen Stimmen auseinanderzusetzen.
Das eigentliche Problem ist nicht der Begriff selbst, sondern ein gesellschaftlicher Zustand: die Erosion von Debattenkultur durch mediale Verkürzung, politische Lagerbildung und eine zunehmende Moralökonomie der Öffentlichkeit. Der Fall Brosius-Gersdorf steht beispielhaft für die Frage, wie wir mit Ambivalenz und Differenz umgehen – nicht nur mit der anderer, sondern auch mit der eigenen.
Weder Verleumdung noch Verklärung sind hier angebracht. Was es braucht, ist eine Debattenkultur, die Widerspruch aushält, Komplexität zulässt und auch unbequeme Fragen nicht reflexhaft ideologisiert. Dies könnte der wahre Prüfstein demokratischer Reife sein – nicht, wie viel Applaus eine Position bekommt, sondern wie viel Dissens sie zulässt.
Im Text genannte Quellen:
- Brosius-Gersdorf, F. & Gersdorf, A. (2021). Stellungnahme zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Universität Potsdam.
- Welt (2024). Gescheiterte Richterwahl: Brosius-Gersdorf rechnet mit Medien und Politik ab.
- FAZ (2024). Brosius-Gersdorf kritisiert „unsachliche“ Medienkampagne.
- Spiegel (2024). Brosius-Gersdorf beklagt „unsachliche und intransparente“ Debatte.
- ZDF (2024). Markus Lanz vom 12. Juni 2024 – Interview mit Brosius-Gersdorf.