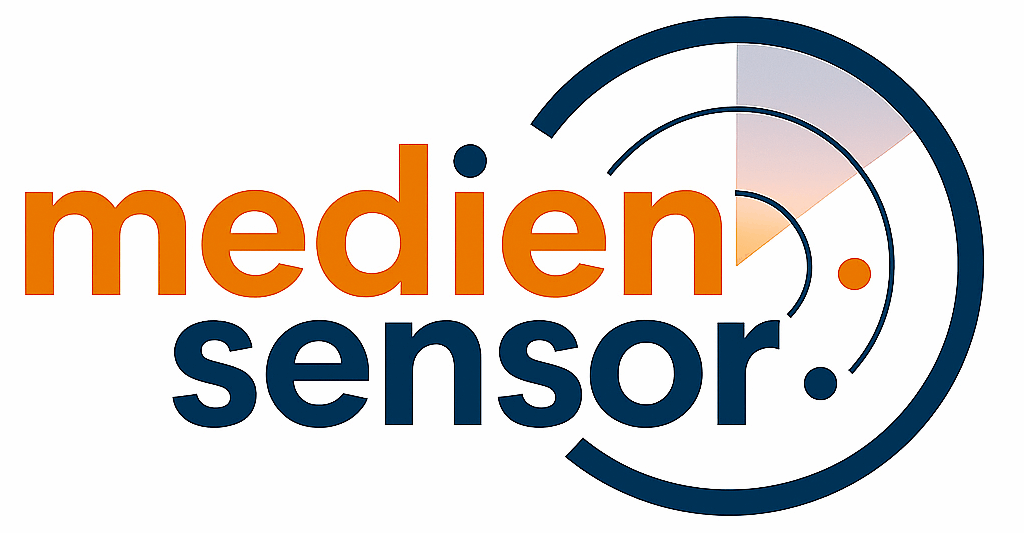Medienkompetenz – ein Begriff, der seit Jahren in Curricula, Strategiepapiere und Bildungskonferenzen gehört. Meist geht es dabei um Fragen wie: Können Schüler:innen Fakten von Fake News unterscheiden? Wissen sie, wie man einen Browser sicher bedient? Kennen sie die Gefahren von Cybermobbing?
Das sind wichtige Fragen – aber sie greifen zu kurz. In einer digitalisierten, vernetzten und durch Algorithmen gesteuerten Gesellschaft bedeutet Medienkompetenz heute weit mehr als das: Sie ist nicht nur technische Fähigkeit, sondern gesellschaftliche Schlüsselkompetenz. Sie entscheidet darüber, wie wir Öffentlichkeit verstehen, wie wir Urteile bilden, wie wir mit Unsicherheit, Widersprüchen und Meinungsmacht umgehen – und ob wir als demokratische Gesellschaft überhaupt noch diskursfähig bleiben.
Medienkompetenz als Gesellschaftskompetenz
Was wir sehen, was wir denken, wem wir glauben – all das wird heute maßgeblich durch Medien geprägt. Durch Plattformen, durch Narrative, durch Likes und algorithmisch sortierte Feeds. Wer Medien nicht nur nutzen, sondern verstehen will, braucht mehr als Know-how – er oder sie braucht Urteilsfähigkeit, Deutungsbewusstsein, Toleranz für Verschiedenheit und ein Gespür dafür, wie sich Medienlogiken in unsere Lebenswirklichkeit einschreiben. Wir nennen das: MedienKompetenz plus.
Eine erweiterte Form von Medienbildung, die nicht bei Technik aufhört, sondern die Macht- und Deutungsfragen stellt. Die fragt: Wer spricht? Wer wird gehört – und wer nicht? Wie beeinflusst der mediale Rahmen meine Wahrnehmung? Was bedeutet es, wenn Schüler:innen vor allem auf TikTok lernen, wie Politik funktioniert? Oder wenn Erwachsene politische Debatten fast ausschließlich durch Schlagzeilen, Kommentarspalten und Erregungswellen erleben?
Noch kein selbstverständlicher Teil von Bildung
Trotz aller Debatten ist Medienkompetenz in vielen Schulen noch immer ein Randthema. Oft fehlen Konzepte, Fortbildungen oder Zeit im Lehrplan. Dabei zeigen Studien immer wieder: Kinder und Jugendliche sind zwar „digital unterwegs“, aber keineswegs „medienkompetent“. Viele haben große Schwierigkeiten, Quellen einzuordnen, Meinungen von Fakten zu unterscheiden oder manipulative Sprache zu erkennen.
Gleichzeitig gilt: Auch Erwachsene – selbst Akademiker:innen – fallen regelmäßig auf Desinformation herein, lassen sich emotional in Empörungszyklen hineinziehen oder haben keine Vorstellung davon, wie Plattformen ihre Aufmerksamkeit lenken. Das zeigt: Medienkompetenz ist keine Altersfrage. Sie ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt – und ein dringendes.
Warum heute digitale Resilienz dazugehört
Neben Wissen und Urteilskraft braucht es heute auch etwas anderes: Medienresilienz oder digitale Resilienz. Sie bezeichnet die Fähigkeit, sich in einem Übermaß an Information, Emotionalisierung und Widerspruch nicht zu verlieren. Wer permanent medial getriggert wird, braucht Schutzräume, Reflexionsräume – und ein Bewusstsein für die eigene Reaktion auf mediale Reize.
Medienkompetenz plus meint deshalb auch: eine Haltung entwickeln, nicht alles glauben, nicht alles liken, nicht alles sofort teilen und sich vor negativen Einflüssen der digitalen Welten schützen können. Uns selbstverständlich auch ein angemessenes und gesundes Maß dafür entwickeln können, wie viel Zeit wir im Netz verbringen und was wir dort tun.
Was wir mit dieser Rubrik wollen
Mit MedienKompetenz plus wollen wir diesen erweiterten Blick fördern. Wir bieten Begriffslexika, Hintergrundwissen und alltagstaugliche Einführungen. Wir richten uns an Lehrkräfte, Pädagog:innen, Studierende, Schüler:innen – und auch an Erwachsene, die ihren Umgang mit Medien hinterfragen möchten.
In unserem Medien|Wissen-Bereich erklären wir zentrale Begriffe: Filterblase, Algorithmus, Framing, Plattformisierung, Diskursmacht – verständlich und fundiert.
Im Lern|Raum entstehen perspektivisch Materialien für Schule und Bildung – mit Anregungen für den Unterricht, Reflexionsaufgaben, aber auch Impulsen für Projektarbeit, Diskussionsrunden oder außerschulische Bildungsarbeit.
Unser Ziel: Wir möchten einen Beitrag leisten für eine Medienbildung, die nicht nur aufklärt, sondern dazu befähigt, Medien als Teil der eigenen Lebenswelt zu begreifen – kritisch, selbstbestimmt und verantwortungsvoll. Denn wer in digitalen Öffentlichkeiten unterwegs ist und wer mitreden will, muss verstehen, wie diese funktionieren.