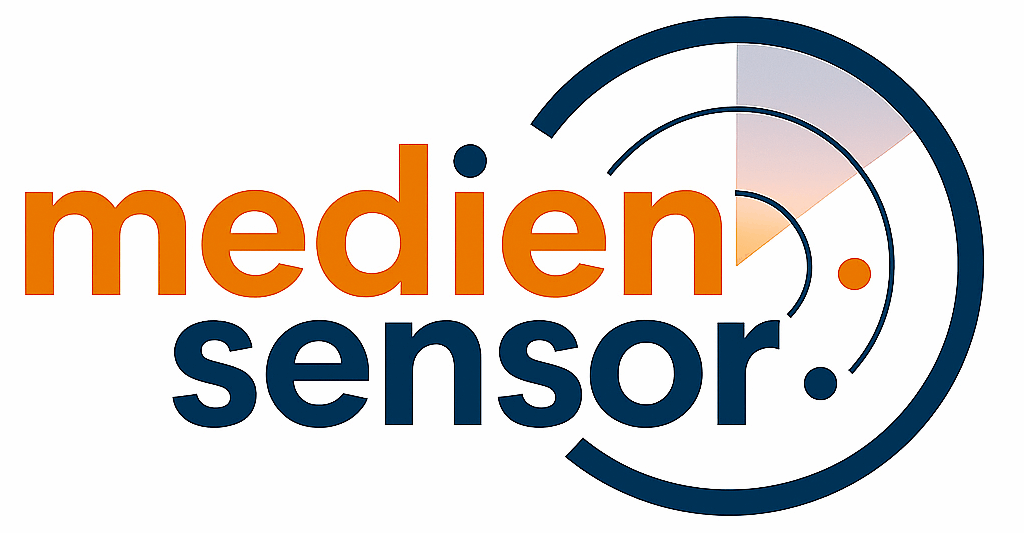Empörung ist zur Währung digitaler Aufmerksamkeit geworden. Wer in sozialen Netzwerken aneckt, landet schnell im Zentrum eines Shitstorms – ob als Wissenschaftler*in, Satiriker*in oder Aktivist*in. Doch was verbirgt sich hinter der moralisch aufgeladenen Debatte um „Cancel Culture“? Geht es um ein neues Schweigeklima – oder um eine überfällige Korrektur kultureller Machtverhältnisse? Dieser Text lotet die Grauzonen zwischen notwendiger Kritik und vorschneller Verurteilung aus und fragt, wie viel Reibung eine demokratische Öffentlichkeit aushalten kann – und muss.
Ein aktuelles Beispiel für diese Spannungsachse ist der Fall Frauke Brosius-Gersdorf. Die renommierte Juristin wurde als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht diskutiert – bis öffentlich gewordene Positionen aus der Pandemiezeit und zum Abtreibungsgesetz gegen sie verwendet wurden. Die Juristin hatte unter anderem die Maßnahmenpolitik während Corona hinterfragt, sich für eine Grundrechtsabwägung ausgesprochen und sogar eine allgemeine Impfpflicht als legitim eingestuft. Gleichzeitig stellte sich jedoch auch heraus, dass Falschbehauptungen über ihre Position zu Schwangerschaftsabbrüchen in Umlauf gebracht worden waren. So stellte die Juristin öffentlich klar, dass sie sich keineswegs für eine Legalisierung und Entkriminalisierung von Abtreibungen nach dem dritten Schwangerschaftsmonat ausgesprochen habe, wie ihr vielfach medial vorgeworfen worden war.
Die Debatte um Cancel Culture begegnet uns in sämtlichen Bereichen – ob Politik, Sport, Unterhaltung, Genderdebatten oder Kindererziehung – und ist medial omnipräsent. So etwa im Fall von verächtlichen Kommentaren über Behindertensportler bei den Paralympics im Satirepodcast „Die Deutschen“ im Herbst 2024. Daraufhin beendeten große Sponsoren wie Babbel die Zusammenarbeit und Veranstalter sagten geplante Auftritte ab. Die Hosts erklärten öffentlich, sich „niemals der Cancel Culture beugen“ zu wollen, warfen ihren Kritikern vor, zensierend aufzutreten und fragten gar: „Was ist, wenn er sich morgen umbringt?“. Diese Reaktion wurde vielfach kritisiert – auch von Journalistenverbänden, die fehlende Selbstreflexion und Schuldumkehr thematisierten (Nizar 2025; Journalistikon 2025).
Die hitzige Diskussion spiegelt die zentrale Dynamik der Cancel-Culture-Kritik: Auf der einen Seite stehen Forderungen nach Konsequenz bei diskriminierenden oder problematisch eingestuften Äußerungen – auf der anderen der Einwand, dass Zensur und Sanktionen die Meinungsfreiheit und den Pluralismus gefährden. Zahlreiche Stimmen warnen, dass derartige Vorfälle zu einer Kultur führen könnten, in der abweichende Meinungen ebenso wie Satire und Provokation stets mit existenziellen Konsequenzen verbunden sind – statt mit einer öffentlichen Auseinandersetzung im Rahmen demokratischer Diskurse (Frontiers 2025; Journalistikon 2025).
Digitale Mobilisierung als Chance für Gerechtigkeit?
Kritiker sehen in derartigen Fällen ein beunruhigendes Signal. Kritik an öffentlichen Figuren ist legitim – sie wird allerdings problematisch, sobald sie zur sozialen oder institutionellen Ausschlussdrohung wird. Zwischen notwendiger Kritik und vorschneller Verurteilung liegt oft nur ein Hashtag. Die Debatten um Winnetou, Lisa Eckhart, Dieter Nuhr oder J.K. Rowling stehen exemplarisch dafür. Insbesondere bei J.K. Rowling führte ein virales Narrativ zu massiven Angriffen – obwohl sie sich mehrfach gegen Diskriminierung ausgesprochen hatte (BBC 2020).
Laut einer Studie des Pew Research Center (2023) geben 46 Prozent der US-amerikanischen Social-Media-Nutzer*innen an, sich bereits aktiv an digitalen Protestformen (etwa durch Hashtags, Share-Aktionen usw.) beteiligt zu haben. Bewegungen wie #MeToo, #BlackLivesMatter oder #FridaysForFuture zeigen deutlich die politisch mobilisierende Wirkung solcher Debatten. Plattformen ermöglichen dabei eine Sichtbarkeit marginalisierter Stimmen beim Publikum – in Echtzeit.
Viele Themen wie sexualisierte Gewalt, struktureller Rassismus oder Queerfeindlichkeit wären ohne digitale Protestformen kaum so weit in die öffentliche Wahrnehmung vorgedrungen. Die Stimme erheben, gemeinsam Haltung zeigen, nicht mehr schweigen – das ist ein berechtigter Ausdruck zivilgesellschaftlicher Teilhabe.
Wo endet Kritik, wo beginnt Canceln?
Eine Untersuchung der Stiftung Neue Verantwortung zeigt, dass deutlich über 40 Prozent der deutschen Internetnutzer*innen Angst haben, im Netz ihre politische Meinung zu äußern, aus Sorge vor öffentlicher Gegenreaktion. Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Wer den Ton in digitalen Debatten angibt, ist nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Studien zeigen, dass besonders meinungsstarke, oft aktivistische Nutzergruppen Debatten auf Twitter & Co. prägen. Der Diskurs wird dadurch nicht nur schärfer, sondern auch selektiver.
Doch nicht jeder digitale Aufschrei bleibt konstruktiv und immer häufiger kippen Debatten in Empörung. Aus Kritik wird ein Urteil ohne Verfahren – und aus der Kraft digitaler Mobilisierung kann politischer und beruflicher Ausschluss resultieren. Studien wie von Brady u.a. (Nature Human Behaviour 2021) belegen, dass Emotion und moralische Empörung im Netz eine erhöhte virale Verbreitung erreichen – sogar unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Inhalte.
Wie viel Widerspruch muss eine offene Gesellschaft aushalten?
Der Meinungsmonitor des Instituts für Demoskopie Allensbach ergab 2023: 44 Prozent der Deutschen haben das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können (Freiheitsindex Deutschland 2023 – IfD Allensbach / Media Tenor). Das ist ein deutlicher Hinweis auf ein wachsendes Unsicherheitsgefühl. Gerade in sensiblen Bereichen wie Geschlechteridentität, Religion oder Migrationspolitik scheinen Zwischentöne immer schwerer möglich. Diese Dynamik bedroht nicht nur Einzelne, sondern das Vertrauen in die demokratische Streitkultur.
Es ist ein Missverständnis zu glauben, Meinungsfreiheit vollziehe sich innerhalb eines Rahmens, der scharfe Kritik nicht zulasse. Und es ist ebenso fatal, wenn das Recht auf Kritik zum sozialen Sanktionsmittel wird. Wenn Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu äußern – nicht aus bloßer Angst vor Gegenrede, sondern vor regelrechter digitaler Vernichtung – hat die Debatte ihren demokratischen Kern verloren.
Die negativen Dynamiken digitaler Empörung sind offensichtlich. Andererseits droht die Gefahr, „Cancel Culture“ vorschnell als (oft politisch motivierten) Kampfbegriff zu verwenden, um berechtigte Kritik zu diskreditieren. Es stellt sich nicht die Frage, ob Kritik überhaupt erlaubt ist, sondern vielmehr, wie wir Kritik äußern, ob sie Raum für Korrektur lässt – oder nur noch für Verurteilung.
Digitale Wende zwischen Diskriminierung und Zensur
Die Herausforderung liegt darin, beides zu ermöglichen: klare Haltung gegen Diskriminierung und gleichzeitig offene Diskussionen über das Wie, das Wann, das Warum. Denn wer Debatten einfordert, muss auch Debatte zulassen. Zugleich müssen wir anerkennen, dass die digitale Wende selbst eine tektonische Verschiebung in der öffentlichen Kommunikation bedeutet hat. Die Plattformisierung gesellschaftlicher Debatten hat alte Gatekeeper abgelöst, aber zugleich neue, intransparente Machtstrukturen geschaffen. Algorithmisch gesteuerte Affektlogiken befördern das Emotionalisierende, Polarisierende und Vereinfachende – nicht das Differenzierte, Mehrdeutige oder Komplexe.
In einer Always-On-Kommunikation, in der Empörung oft performativer Ausdruck digitaler Zugehörigkeit ist, können Shitstorms innerhalb weniger Stunden Karrieren und Ruf massiv schädigen – unabhängig vom Kontext. Hinzu kommen Trolling, gezielte Desinformationskampagnen und Hassrede, die in der hypervernetzten Struktur digitaler Öffentlichkeiten schwer zu bändigen sind. Die Folge ist eine komplexe Wechselwirkung: Der Druck, moralisch eindeutig Position zu beziehen, steigt – während die Fähigkeit, Ambivalenz auszuhalten oder rationale Auseinandersetzungen zu führen, sinkt. Cancel Culture gedeiht nicht in einem Vakuum, sondern ist Symptom und Verstärker einer Medienlogik, die Emotionalisierung über Argumentation stellt.
Demokratische Streitkultur lebt auch und gerade vom Zweifel, nicht von Dogma. Wer Pluralität fordert, muss auch Ambivalenz ertragen. Eine neue Debattenkultur lebt daher nicht von einer Verbotsrhetorik, sondern insbesondere von Vertrauen in das argumentative Ringen um Wahrheit. Sie braucht Räume für Kritik, ohne Tribunal – und sie braucht den Mut, zwischen berechtigtem Protest und destruktivem Vernichtungswillen zu unterscheiden. Denn nur eine Gesellschaft, die Widerspruch aushält und sich diesem mit Argumenten stellt, bleibt wirklich frei.
Im Beitrag erwähnte Quellen:
- ntv (2024): Nizar Akremi nach Behindertenwitz unter Druck (https://www.n-tv.de/leute/Podcaster-Nizar-Akremi-nach-Behindertenwitz-unter-Druck-article24880510.html)
- t-online (2024): Babbel beendet Kooperation mit Nizar Akremi (https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_100354788/babbel-beendet-kooperation-mit-nizar-akremi.html)
- Deutschlandfunk Kultur (2024): Humor oder Hass? Warum die Debatte um Cancel Culture so polarisiert (https://www.deutschlandfunkkultur.de/cancel-culture-und-comedy-nizar-100.html)
- Journalistikon (2025): Cancel Culture oder Konsequenz? Der Fall Akremi im Medienspiegel (https://www.journalistikon.de/2025/01/fall-nizar-akremi-und-die-grenzen-der-meinungsfreiheit)
- Pew Research Center (2023): Americans’ Views of and Experiences With Activism on Social Media
- IfD Allensbach / Media Tenor (2023): Freiheitsindex Deutschland 2023
- Brosius‑Gersdorf, Frauke & Gersdorf, rechte Gutachter (2021): Rechtsgutachten zur allgemeinen Impfpflicht in der Pandemie
- Spiegel (2024): Brosius‑Gersdorf widerspricht medialen Darstellungen zum Abtreibungsrecht
- ZDF Markus Lanz (2024): Interview mit Frauke Brosius‑Gersdorf
- Brady, W.J. et al. (2021): Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks, Nature Human Behaviour
- BBC (2020): Bericht zu J.K. Rowling und öffentlicher Debatte