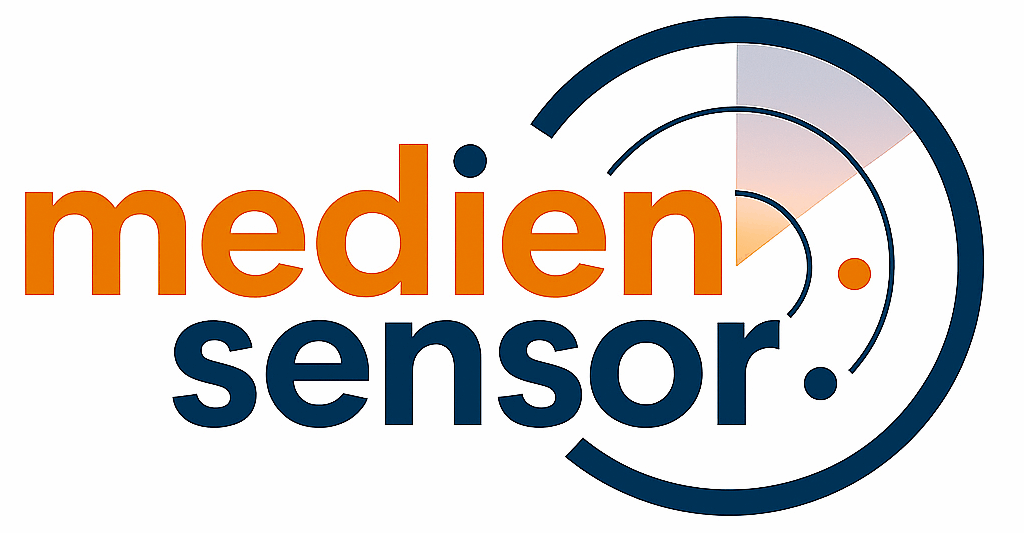Im Frühjahr 2020 schien die Welt stillzustehen – physisch jedenfalls. Doch digital und diskursiv entfaltete sich eine der dynamischsten Kommunikationskrisen der letzten Jahrzehnte. Aus einer medizinischen Bedrohung wurde ein globales Narrativ, das unser Denken, Sprechen und Handeln bis heute beeinflusst. Die Pandemie wurde nicht nur biologisch, sondern auch symbolisch – sie formte kollektive Ängste, identitäre Zuschreibungen und gesellschaftliche Bruchlinien.
Philosophen wie Giorgio Agamben warnten früh vor einer „Biopolitik des Ausnahmezustands“, bei der unter dem Vorwand der Sicherheit demokratische Grundrechte ausgehöhlt würden (Agamben 2020). Andere, wie Jürgen Habermas, sahen in der frühen Einhegung des Virus einen Akt globaler Vernunft (Habermas 2020). Doch dazwischen verblasste rasch der Raum für differenzierte Stimmen – auch, weil sich mediale Narrative als dominante Orientierungsrahmen durchsetzten.
Heute, vier Jahre später, fordern immer mehr Stimmen – von Bürgerinitiativen bis hin zu Politikern wie Wolfgang Kubicki – eine systematische Aufarbeitung der Corona-Zeit (Kubicki 2023). Was wurde bewusst verschwiegen? Welche Informationen wurden aus politischen oder strategischen Gründen zurückgehalten? Recherchen legen nahe, dass etwa die Zweifel an der Übertragungswirkung der Impfung in frühen Phasen bekannt waren, jedoch kaum kommuniziert wurden (EU-Parlament: Pfizer-Anhörung 2022). Auch das Bundesgesundheitsministerium verweigerte über Monate hinweg die Offenlegung bestimmter Daten zum Nutzen-Risiko-Verhältnis – etwa bei Kinderimpfungen oder zu Impfdurchbrüchen (BMG-Anfrage Bundestag 2022).
Narrative gegen Wissenschaft und Vielfalt
Narrative können Erkenntnis ermöglichen – oder verstellen. Während der Pandemie entwickelte sich eine gefährliche Tendenz zur Wissenschaftsmonopolisierung. Die Formel „Follow the Science“ wurde nicht als Einladung zur pluralen Diskussion verstanden, sondern als Dogma (Ioannidis 2021). Wissenschaftliche Institutionen, die sich außerhalb der dominanten Meinungsachsen bewegten – etwa Vertreter evidenzbasierter Medizin oder Public-Health-Expert*innen mit abweichenden Risikoeinschätzungen – wurden medial ignoriert oder diskreditiert.
Kritische Stimmen innerhalb der Wissenschaft, etwa zur Effektivität von Lockdowns (Bendavid u.a. 2021) oder zur altersbezogenen Risikodifferenzierung (Ioannidis 2020), fanden selten Gehör. Auch Literaten und Intellektuelle – von Juli Zeh bis Alexander Kluge – mahnten an, dass Gesellschaft nicht nur aus vorherrschenden Thesen der Virologie bestehe (Zeh 2020). Doch wer versuchte, diese Perspektiven in die Öffentlichkeit zu tragen, wurde schnell mit Etiketten belegt. Narrative bildeten rasch eine Filterblase, in der nur das als legitim galt, was ins Raster passte.
Ein besonders aufschlussreiches Beispiel war die Debatte um ein Gedicht, das Kurt Tucholsky zugeschrieben wurde – ein emotionales Plädoyer für die Impfpflicht. Später stellte sich heraus: Das Gedicht war eine Fälschung (Correctiv 2021). Doch es wurde vielfach zitiert, auch von Medien, als moralischer Beistand für die Impfkampagne. Gerade Tucholsky, bekannt für seinen scharfen Blick auf Machtmissbrauch und für seinen Einsatz für persönliche Freiheit, hätte wohl kaum ein staatliches Pflichtregime poetisch verklärt. Der Fall zeigt: Narrative setzen sich oft auch gegen historische Wahrheit durch – wenn sie in ein emotionales Weltbild passen.
Medien, Zensur und Desinformation
Ein weiteres Phänomen: Die Medien gerieten unter enormen Druck – sowohl strukturell als auch ideologisch. Öffentlich-rechtliche Sender folgten häufig einer einheitlichen Linie, kritische Beiträge waren Ausnahmen (Programmanalyse NDR 2021). Plattformen wie YouTube oder Facebook löschten Inhalte, die den offiziellen Empfehlungen widersprachen – selbst wenn sie sachlich fundiert waren (Stanford Internet Observatory 2022). Diese Form der „präventiven Zensur“ wurde mit der Bekämpfung von Desinformation begründet, führte aber de facto zur Marginalisierung berechtigter Kritik.
So wurde etwa eine frühe Diskussion um das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Kinderimpfungen aus dem Diskurs verdrängt. Rückblickend zeigen Daten der STIKO und internationaler Studien, dass der Nutzen bei gesunden Kindern vergleichsweise gering war (STIKO-Empfehlung 2021; UK JCVI 2021). Dennoch wurden Kritiker dieser Maßnahmen – darunter Kinderärzte, Immunologen und Wissenschaftsjournalist*innen – öffentlich diskreditiert. Narrative ersetzten wissenschaftliche Differenzierung. Wer widersprach, wurde in sozialen Netzwerken teils regelrecht gecancelt, etwa der Arzt Gunter Frank oder der Datenanalyst Tom Lausen (Lausen 2022), obwohl ihre Argumente später in vielen Teilen bestätigt wurden.
Diskurskontrolle durch Zuschreibung: Politische Lager oder „Verschwörungstheorie“
Eine solche strategische Diskurskontrolle funktioniert nicht nur über die Auswahl dessen, was gesagt wird, sondern vor allem über die Rahmung dessen, wer etwas sagt. Die Zuschreibung einer bestimmten ideologischen Zugehörigkeit – ob z.T. berechtigt oder auch nicht – verändert die Wahrnehmung der Argumente grundlegend. In der Pandemiezeit wurde dies zu einem wirkungsvollen Werkzeug: Wer etwa Zweifel an der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen äußerte, fand sich schnell in der Kategorie „Corona-Skeptiker“ oder gar „Verschwörungstheoretiker“ wieder. Diese Etiketten wirkten wie eine diskursive Immunisierung: Die Inhalte mussten nicht mehr geprüft oder inhaltlich entkräftet werden, da die Person als Quelle bereits diskreditiert war. Damit verschob sich der Streit um Argumente zu einem Streit um Etiketten – eine Entwicklung, die die Kultur des offenen Austauschs gefährdet.
Diese Form der Lagerzuschreibung traf längst nicht nur „extreme“ oder „verschwörungsideologische“ Positionen. Auch differenzierte Kritiker*innen – ob Stimmen aus der Wissenschaft, Kultur, Unterhaltung, den Medien oder aus dem Volk– gerieten so unter Generalverdacht. Diese Form der Pauschalisierung erzeugt nicht nur ein Klima der Einschüchterung, sondern führt zu einer ungesunden Selbstzensur. Wer das Risiko einer politischen oder sozialen Stigmatisierung scheut, schweigt eher, als sich öffentlich in eine vermeintlich „verdächtige“ Ecke stellen zu lassen. Damit aber wird ein zentrales Versprechen demokratischer Öffentlichkeit ausgehöhlt: dass jede fundierte Position, unabhängig von ihrer vermeintlichen politischen Verortung, gehört und diskutiert werden kann. Die Erfahrung der Corona-Jahre zeigt, wie notwendig es ist, diese Muster zu durchbrechen, wenn künftige Krisen nicht erneut in eine Spirale aus Polarisierung und Delegitimierung abweichender Stimmen geraten sollen.
Politik und Macht durch Erzählung
Politische Akteure nutzten das dominante Corona-Narrativ gezielt zur Steuerung von Verhalten – und Meinung. Die Kommunikation durch Angstbilder, wie das interne „Panikpapier“ des Bundesinnenministeriums 2020 belegt, war kein Zufall, sondern Strategie (BMI-Strategiepapier 2020). Auch das Framing in offiziellen Statements – von der „Pandemie der Ungeimpften“ bis zur „Solidaritätsverweigerung“ – trug zur Polarisierung bei (Tagesschau 2021). Narrative wurden zur politischen Waffe: Wer nicht folgte, wurde schnell moralisch delegitimiert.
Besonders brisant: Die Regierung stützte sich auf handverlesene Expertenzirkel, deren Positionen als „wissenschaftlicher Konsens“ verkauft wurden (Wissenschaftlicher Corona-Krisenstab 2021). Inzwischen ist bekannt, dass interne Widersprüche und Unsicherheiten kaum kommuniziert wurden – etwa zur Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Infektion (EMA 2021) oder zur Rolle asymptomatischer Übertragung (WHO 2020). Diese selektive Kommunikation wirft Fragen auf zur politischen Verantwortung – und zur bewussten Gestaltung öffentlicher Erzählungen als Machtinstrument.
Lehren aus der Krise – zwischen Aufklärung und Selbstkritik
Die Corona-Zeit war nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern eine Krise demokratischer Öffentlichkeit. Narrative ersetzten Debatte, Konformität überlagerte Kritik (Dahlgren 2021). Wer heute Aufarbeitung fordert, verlangt nicht nur rückblickende Gerechtigkeit – sondern demokratische Resilienz.
Wir müssen lernen, mit Unsicherheit, Dissens und Komplexität umzugehen. Und das beginnt mit einem offenen Umgang mit Narrativen: Wer konstruktiv streiten will, darf nicht nur Fakten prüfen, sondern auch die Erzählmuster hinterfragen, die ihnen Bedeutung verleihen. Nur so können wir verhindern, dass auch künftige Krisen mit simplen Dichotomien statt mit kritischer Vielfalt beantwortet werden.
Der Fall der gefälschten Tucholsky-Zeilen ist mehr als ein kurioser Fehlgriff – er steht exemplarisch für eine Zeit, in der emotionale Stimmigkeit oft höher gewertet wurde als historische und wissenschaftliche Präzision. Und genau deshalb bleibt die zentrale Aufgabe: Narrative sichtbar machen, Machtstrukturen offenlegen, Reflexionsräume schaffen. Denn wenn Erzählungen Wirklichkeit formen, müssen wir lernen, sie zu lesen – und zu durchbrechen.
Im Text genannte und ausgewählte Quellen:
- Zeh, J. (2020). Fragen an die Politik in der Pandemie. Interview in Die Zeit, 28. Mai 2020.
- SproutSocial (2023): Everything You Need to Know About Social Media Algorithms
- Agamben, G. (2020). A che punto siamo? L’epidemia come politica. Quodlibet.
- Bendavid, E., Oh, C., Bhattacharya, J., & Ioannidis, J. P. A. (2021). Assessing mandatory stay‐at‐home and business closure effects on the spread of COVID‐19. European Journal of Clinical Investigation, 51(4), e13484. https://doi.org/10.1111/eci.13484
- BMI. (2020). Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen. Strategiepapiersammlung des Bundesinnenministeriums (intern, später veröffentlicht).
- BMG. (2022). Antwort auf parlamentarische Anfrage zu COVID-19-Impfdaten. Deutscher Bundestag, Drucksachen.
- Boyd, D. (2010). Social Network Sites as Networked Publics. In M. Papacharissi (Hrsg.), A Networked Self (S. 39–58). Routledge.
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. Nature Human Behaviour, 5, 12–16. https://doi.org/10.1038/s41562-020-01022-1
- Correctiv. (2021). Kein Tucholsky-Gedicht zur Impfpflicht – Fälschung entlarvt. https://correctiv.org
- Dahlgren, P. (2021). The COVID-19 pandemic and the crisis of democracy: The role of disinformation and polarization. Javnost – The Public, 28(2), 135–150.
- EMA. (2021). Comirnaty and Spikevax: No change to recommendations on vaccination. European Medicines Agency.
- EU-Parlament. (2022). Pfizer hearing on COVID-19 vaccine transmission. Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI), 10. Oktober 2022.
- Habermas, J. (2020). Ein Plädoyer für Vernunft in der Pandemie. Süddeutsche Zeitung, 10. April 2020.
- Ioannidis, J. P. A. (2020). Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bulletin of the World Health Organization, 99(1), 19–33. https://doi.org/10.2471/BLT.20.265892
- Ioannidis, J. P. A. (2021). Why most published research findings are false — revisited in the COVID-19 era. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 27(6), 1121–1123.
- JCVI. (2021). JCVI statement on COVID-19 vaccination of children aged 12 to 15 years: 3 September 2021. UK Joint Committee on Vaccination and Immunisation.
- Kubicki, W. (2023). Meinungsfreiheit und Aufarbeitung nach Corona. Rede im Deutschen Bundestag, 12. Januar 2023.
- Lausen, T. (2022). Die Intensivbettenlüge: Wie ein Gesetz den Weg zur Corona-Diktatur ebnete. Rubikon.
- NDR. (2021). Programmanalyse: Corona-Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
- Stanford Internet Observatory. (2022). Censorship and moderation of COVID-19 content. Stanford University.
- STIKO. (2021). Epidemiologisches Bulletin Nr. 32/2021. Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut.
- Tagesschau. (2021). „Pandemie der Ungeimpften“ – Debattenbeitrag aus Regierungspressekonferenz. ARD Tagesschau, 28. Oktober 2021.
- WHO. (2020). Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. World Health Organization.