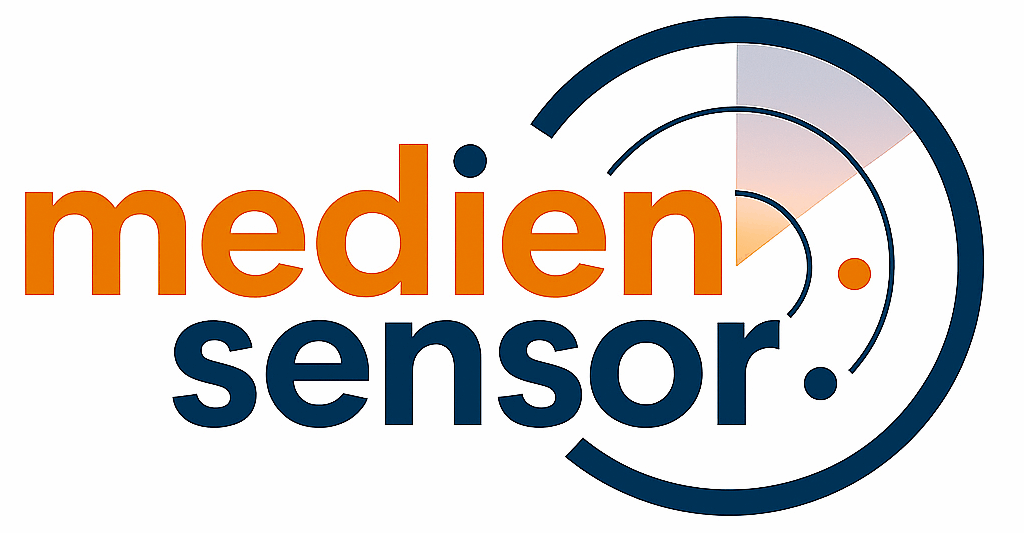Ein Krieg tobt in Gaza und auch in den Kommentarspalten der westlichen Welt ist kein Waffenstillstand in Sicht. Es geht nicht nur um Fakten oder geopolitische Konstellationen, sondern immer wieder darum, welches Narrativ sich durchsetzt – etwa: Ist Israel ein Verteidiger westlicher Werte oder ein Aggressor? Sind palästinensische Demonstrationen Ausdruck von Befreiungskampf oder antisemitischer Eskalation? Gleichzeitig steht die Protestbewegung „Letzte Generation“ immer wieder im medialen Fokus. Sind ihre Aktionen ziviler Ungehorsam im Dienst des Klimaschutzes oder radikale Nötigung der Bevölkerung? Schützt die neue Wokeness marginalisierte Gruppen oder zerstört sie unsere Kultur?
Diese Beispiele zeigen: Viele öffentliche Debatten werden nicht mehr primär durch offene Argumentation geprägt, sondern durch konkurrierende Erzählmuster. Narrative spielen für menschliche Sichtweisen und soziale Interaktion eine fundamentale Rolle. Sie werden nicht nur gezielt konstruiert, sie entstehen bereits bei dem beständigen Versuch jedes/r Einzelnen, in unserer Umwelt Kausalitäten und Muster zu erkennen und Ereignisse in einen sinnhaften Zusammenhang zu bringen. Somit bieten Narrative Orientierung, fördern Verstehensprozesse und schaffen Identität – aber sie können auch manipulieren, verzerren, ausschließen und spalten. Sie verdichten Wirklichkeit zu emotional aufgeladenen Sinnbildern, die oft mehr über politische und gesellschaftliche Machtverhältnisse sowie soziale Affekte verraten als über die tatsächliche Lage. Immer öfter ersetzen Narrative die nüchterne Analyse durch eine moralisch aufgeladene Erzählung, die Abweichung nicht duldet, sondern sanktioniert.
Abgrenzung, Antagonie und Heldengeschichten
Ein Narrativ ist mehr als eine Geschichte. Es ist eine tief verankerte Rahmung, die bestimmten Fakten Bedeutung verleiht und andere ausblendet. Der Linguist George Lakoff beschreibt sie als „Frames“, also Deutungsraster, die unser Denken strukturieren. Menschen sind narrative Wesen: Wir verarbeiten die Welt permanent in Geschichten, nicht in abstrakten Daten. Das macht Narrative auch so mächtig: Sie vereinfachen Komplexität, bieten emotionalen Halt, schaffen Zugehörigkeit und Sinnstrukturen. Wer ein Narrativ kontrolliert, beeinflusst nicht nur Meinungen, sondern Realitätswahrnehmung. Die politische sowie wirtschaftlich orientierte strategische Kommunikation hat das erkannt – und perfektioniert. Von PR-Strategien über Framing in Leitmedien bis hin zu Social-Media-Kampagnen reicht das Repertoire jener, die bewusst mit Narrativen arbeiten.
Zudem entfalten Narrative nicht nur Wirkung durch Wiederholung, sondern insbesondere auch durch Antagonisten und Ausschluss: Was nicht in das dominante Narrativ passt, wird schnell als randständig, falsch, schlecht, extrem oder irrational gebrandmarkt. Die Konsequenz ist ein sozialer Konformitätsdruck, der gerade in digitalen Räumen durch Likes, Algorithmen und Shitstorms reguliert wird. Zudem funktionieren Narrative umso besser, wenn wir sie mit klassischen Heldengeschichten verbinden – so wurde etwa Greta Thunberg medial vielfach zur Symbolfigur stilisiert: Schnell galt sie als eine Art moderne Jeanne d’Arc des Klimas – jung, kompromisslos und von höherer Mission beseelt. Das machte sie sowohl zur Ikone für Aktivist*innen als auch zur Projektionsfläche für scharfe Kritik: Während viele deutsche Leitmedien sie als mutige Mahnerin feierten, bezeichneten sie vor allem konservative Stimmen aus den USA als „Marionette“ grüner Eliten. Das dort verbreitete Narrativ war weniger heroisch als polarisierend – sie wurde zum Symbol eines übergriffigen und irrationalen Klimaaktivismus, der persönliche Freiheit und wirtschaftliche Interessen bedrohe.
Die neue Logik der Öffentlichkeit
Digitale Plattformen haben die öffentliche Kommunikation radikal verändert. Was sichtbar wird, entscheidet nicht mehr ein diskursives Ideal, sondern eine Logik der Reaktion: Je emotionaler und bewegender, desto viraler. Likes, Shares und Empörung schlagen Nachdenklichkeit und Reflexion. Die Algorithmen großer Netzwerke wie Facebook, TikTok oder X (vormals Twitter) sind so programmiert, dass sie Inhalte bevorzugen, die starke Affekte hervorrufen – weniger der Wahrheitsgehalt oder die gesellschaftliche Relevanz stehen im Vordergrund, sondern Klickzahlen und Verweildauer.
Algorithmen bevorzugen Reiz über Reflexion. Studien zeigen: Inhalte, die Begeisterung, Wut, Angst oder moralische Empörung auslösen, verbreiten sich wesentlich schneller (Brady u.a. 2020/19, Journal of Experimental Psychology: General). Das führt zur Verstärkung von Narrativen, die in einfache Lager spalten – Gut versus Böse, Opfer versus Täter, Fortschritt versus Bedrohung. Die Plattformisierung der Öffentlichkeit verschiebt dabei die Machtverhältnisse: Klassische Instanzen wie professioneller Journalismus oder wissenschaftliche Prinzipien verlieren durch diese Dynamik zunehmend an Einfluss, während affektgetriebene Meinungsführer*innen schneller Reichweite erzielen.
Diese Dynamik macht differenzierte Positionen zunehmend unsichtbar und verwandelt Komplexität in Konflikt. Zudem setzt sie Anreize, weniger der Wahrheit auf den Grund zu gehen als Aufmerksamkeit zu generieren. Das Ergebnis ist eine fortschreitende Fragmentierung der Wirklichkeit, bei der das verbindende Gespräch durch die digitalisierte Gesellschaft mehr und mehr durch parallele Echokammern ersetzt wird.
Narrative als Mittel der Ausgrenzung
Immer öfter beobachten wir: Kritik an hegemonialen Narrativen wird nicht argumentativ entkräftet, sondern moralisch delegitimiert. Wer etwa berechtigte Fragen zur neuartigen Impfung stellte, galt in der Öffentlichkeit schnell als verdächtig, unsolidarisch oder sogar radikal – obwohl sich herausstellte, dass die Corona-Impfung nicht vor Ansteckung und Verbreitung schützte. Wer die deutsche Israelpolitik differenziert betrachtet, steht schnell im Verdacht, antisemitische Narrative zu bedienen. Wer zentrale Fragen zur Migrationspolitik humanitär oder pragmatisch gestalten will, gilt schnell als „linksgrün verblendet“, wer Klimamaßnahmen kritisiert, wird hingegen gerne als „reaktionär“ abgetan – selbst wenn berechtigte Zweifel an deren Wirksamkeit und Effizienz bestehen.
Kritische Stimmen warnen in diesem Zusammenhang vor einer Diskursverengung, in der mediale Leitlinien faktisch definieren, was gesagt werden darf und was nicht. Medienkritische Plattformen wie Correctiv verteidigen solche Diskurslinien als notwendigen Schutz vor Desinformation – ein Anliegen, das angesichts zahlreicher Fake-News-Kampagnen seine Berechtigung hat, aber dringliche Fragen nach Macht, Kontrolle und Deutungshoheit aufwirft. Die Übermedien betonen journalistische Standards und warnen vor einer zu starken Relativierung evidenzbasierter Positionen, während die NachDenkSeiten die Freiheit politischer Diskurse durch dominierende Narrative deutlich in Gefahr sehen. Der Dissens zwischen den Medienportalen zeigt exemplarisch, wie verschieden der Umgang mit abweichenden Meinungen bewertet wird.
Insbesondere in unserer digitalisierten Gesellschaft wird nicht einfach diskutiert, sondern vielfach selektiert: Wer gehört noch zur legitimen Öffentlichkeit – und wer wird durch diskursive Labels ausgeschlossen? Narrative übernehmen hier die Funktion von moralischen Kategorisierungsmaschinen. Was nicht konform erscheint, wird nicht nur ignoriert, sondern immer wieder aktiv diskreditiert.
Narrative gegen den Pluralismus?
Der Begriff „Cancel Culture“ ist selbst Teil eines Narrativs politisch aufgeladener Positionen. Doch jenseits der ideologischen Frontlinien und politischer Zuweisungen von „links“ oder „rechts“ zeigt sich ein reales Problem: Immer mehr Menschen haben das Gefühl, nicht mehr frei sprechen zu können, ohne soziale oder berufliche Nachteile zu riskieren (IfD Allensbach & Media Tenor: Freiheitsindex 2023).
Die aktuelle Debatte um die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin ist hier symptomatisch: Ihre umstrittene Haltung zur Impfpflicht zu Corona-Zeiten wurde einerseits als rechtlich vertretbar, andererseits als moralisch bedenklich und wissenschaftlich nicht fundiert empfunden. Die Debatte darüber kippte schnell: Teilweise mit falschen Anschuldigungen wurde die Juristin in den Medien heftig attackiert. Wer sie kritisierte, galt jedoch schnell pauschal als Teil eines „rechtspopulistischen Shitstorms“ und eine differenzierte Kritik wurde marginalisiert.
Narrative können zur reputativen Waffe werden, wenn sie pauschal zuordnen: politisch „rechts“ oder „links“, „verblendet“, „radikal“. In diesem Sinne wird mit dem Verweis auf gefährliche Narrative oft selbst eines geschaffen – ein ideologisch aufgeladenes Klima, das echte Vielstimmigkeit zunehmend verhindert. Moralisierung ersetzt dann rationales Abwägen, Empörung verdrängt Argumente und die Grenzen des Sagbaren werden enger gezogen – nicht aus Gesetz, sondern aus sozialer Kontrolle.
Meinungsfreiheit statt Meinungseinheit
Es geht nicht darum, sämtliche Narrative zu verwerfen – Narrative sind wichtig und ohne sie könnten wir uns in der Welt kaum zurechtfinden. Aber es ist auch entscheidend, sie zu erkennen, zu hinterfragen und zu relativieren. Wer nur noch in Erklärungen lebt, die alles bestätigen, verliert den Zugang zum Dialog.
Eine aufgeklärte Öffentlichkeit braucht keine neue Meinungseinheit, sondern die Bereitschaft, auch Unsicherheiten, Differenz und Komplexität auszuhalten, Widersprüche zuzulassen und sich der eigenen Perspektivgebundenheit bewusst zu werden. Die entscheidende Gefahr liegt nicht darin, dass Narrative überhaupt existieren, sondern darin, dass wir sie unbewusst übernehmen, ohne sie als das zu erkennen, was sie sind: selektive Erzählungen, hinter denen sich auch Machtansprüche verbergen. Narrative sind nicht in Stein gemeißelt, sie können auch kritisch hinterfragt, neu überdacht und ggf. korrigiert werden. Nur dort, wo Narrative nicht zur Waffe, sondern zum Gesprächsanlass werden, entsteht das, was eine demokratische Gesellschaft ausmacht: Diskussionen mit Anstand und Argumenten, Kritik ohne Diffamierung und Erkenntnis jenseits der Echokammer.
Im Text genannte Quellen:
- Brady, W.J., Gantman, A.P. & Van Bavel, J.J. (2020, online First 2019): Attentional capture helps explain why moral and emotional content go viral – veröffentlicht im Journal of Experimental Psychology: General. Mora
- IfD Allensbach / Media Tenor (2023): Freiheitsindex Deutschland
- NachDenkSeiten (2024): Diskursverengung als Gefahr für Demokratie
- Correctiv (2024): Faktencheck zur Cancel-Culture-Debatte
- Übermedien (2024): Kommentar zur Empörungskultur