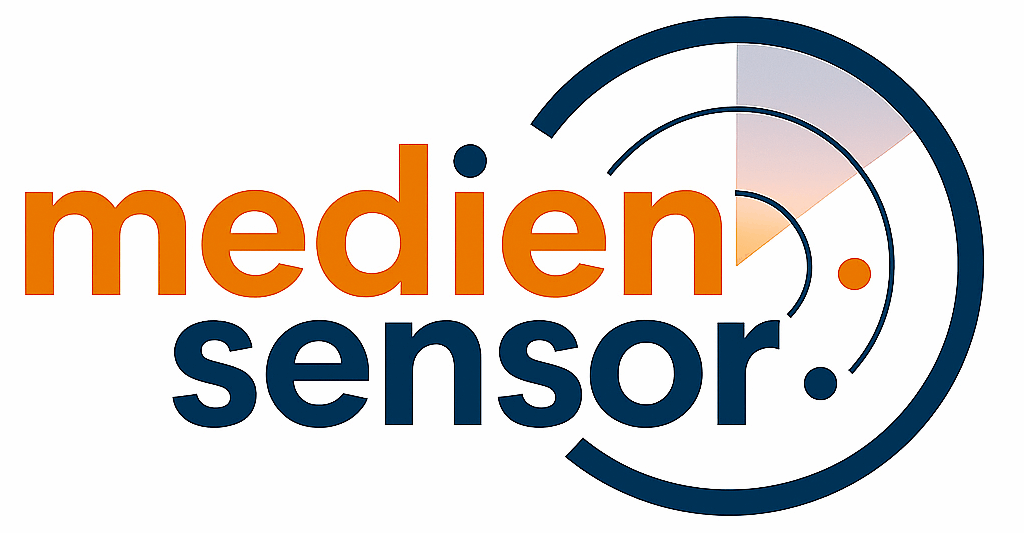Die Digitalisierung hat das Klassenzimmer erreicht – leise, aber radikal. Während früher Beamer, Computerraum und Overheadprojektor als Ausweis technischer Modernität galten, sind es heute Lernplattformen, Tablets und neuerdings sogar KI-gestützte Assistenzsysteme. Kinder und Jugendliche wachsen längst in einer Welt auf, in der Wissen jederzeit verfügbar ist, in der Kommunikation sekundenschnell passiert – und in der das Smartphone oft näher ist als die nächste Lehrkraft. Doch wie verändert diese neue Lernrealität den Unterricht? Und was bedeutet sie für das pädagogische Selbstverständnis von Schulen, Eltern und Lehrkräften?
Die Corona-Pandemie wirkte wie ein Brandbeschleuniger: Binnen weniger Monate mussten Schulen auf digitalen Fernunterricht umstellen – mit allen Herausforderungen und Chancen, die damit einhergingen. Viele dieser Entwicklungen sind geblieben: Lernmanagementsysteme wie Moodle, interaktive Whiteboards oder KI-basierte Tools gehören inzwischen für zahlreiche Schulen zum Alltag – und prompt folgte die Kritik: Ein früher Einsatz von iPads erweise sich in vielen Fällen als hinderlich für den Lernerfolg von Grundschüler*innen, insbesondere im Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen und der Schulung von Gedächtnis und Konzentration.
Zentrale Fragen werden somit immer dringlicher: Ist Digitalisierung im Klassenzimmer ein Gewinn oder doch ein Rückschritt im Bildungssystem? Wie kann digitaler Unterricht sinnvoll gestaltet werden? Wie kann man den Schüler*innen eine ausreichende Medienkompetenz vermitteln und sind die Lehrer*innen hier umfassend geschult?
Rückbesinnung auf analoges Lernen
In Bayern wurden ursprünglich iPads für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse fest eingeplant. Doch Ministerpräsident Markus Söder kündigte Anfang 2024 eine Kehrtwende an: Tablets sollen nun erst ab Klasse 8 eingeführt werden – deutlich später als ursprünglich vorgesehen. Begründet wurde dies mit „Bildungsforschung und Praxiserfahrungen“, die den Nutzen früher Digitalisierung infrage stellten.
Bildungsexperten wie Klaus Zierer von der Universität Augsburg unterstützen diesen Schritt. Zierer verweist auf internationale Studien, die zeigen, dass eine zu frühe und ungeplante Digitalisierung zu einer digitalen Überforderung führe und besonders in Grundschulen Lese-, Schreib- und Konzentrationsfähigkeit gefährden könne. Kinder bräuchten zunächst eine sichere Grundlage in analogen Techniken, bevor digitale Medien als Werkzeug eingesetzt werden sollten.
Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLLV) sprach sich in diesem Zusammenhang gegen eine zu frühe Digitalisierung aus. Präsidentin Simone Fleischmann betonte, dass das „digitale Heilsversprechen“ sich im Schulalltag so nicht bestätigt habe. Vielmehr brauche es klare pädagogische Konzepte statt Technik um der Technik willen (BLLV 2024).
Diese Debatte spiegelt eine breitere europäische Entwicklung wider: In Ländern wie Schweden kommt es zu einem Rückbau der digitalen Schulpolitik – insbesondere in Grundschulen. Die schwedische Bildungsministerin Lotta Edholm kündigte 2023 an, Tablets in frühen Jahrgängen durch klassische Bücher und Handschrifttraining zu ersetzen. Hintergrund war ein Rückgang der Lesekompetenz schwedischer Viertklässler im internationalen Vergleich (PIRLS-Studie 2021). Die Digitalisierung sei zu schnell und ohne ausreichende wissenschaftliche Fundierung erfolgt (Associated Press 2023).
Technik ersetzt keine Haltung
Der Einsatz digitaler Medien braucht didaktisches Bewusstsein. Nicht jede neue App ist ein Fortschritt, nicht jede Innovation eine Verbesserung. Vielmehr stellt sich die Frage, welche Lernprozesse durch Technik überhaupt sinnvoll unterstützt werden können – und welche besser analog bleiben. Lesen, Schreiben, Diskutieren, Forschen – diese Fähigkeiten entstehen nicht durch bloßen Zugang zu Informationen, sondern durch Einübung, Wiederholung und Anleitung.
Zudem zeigt sich: Technik wirkt nicht gleich – sie wirkt kontextabhängig. Schüler*innen aus sozioökonomisch schwächeren Haushalten profitieren nicht automatisch von mehr Digitalisierung, wenn die familiäre Unterstützung fehlt. Studien belegen, dass der „digitale Graben“ eher größer geworden ist: Während manche Kinder an hybriden Lernangeboten wachsen, verlieren andere den Anschluss (OECD 2025). Digitalisierung ohne soziale Begleitung verstärkt Ungleichheit.
Was Schulen wirklich brauchen
Was also ist zu tun? Schulen brauchen keine immer neuen Geräte, sondern vor allem Konzepte. Pädagogisch durchdachte Mediencurricula, gezielte Medienkompetenzförderung, Fortbildungen für Lehrkräfte, verständliche Regeln im Umgang mit Geräten und vor allem Zeit für Reflexion. Medienkompetenz darf nicht an Plattformgrenzen enden – sie muss Quellenkritik, Datenschutz, Desinformationsbewusstsein und ethische Fragen umfassen. Ein sinnvoller Umgang mit digitalen Medien bedeutet auch, Zeiten des Verzichts einzuräumen: digitale Pausen, analoge Lernphasen, Räume ohne WLAN.
Auch Eltern spielen dabei eine Schlüsselrolle. Wenn zu Hause keine Regeln für Bildschirmzeiten gelten oder Vorbilder fehlen, können Schulen nur bedingt gegensteuern. Deshalb braucht es eine neue Partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus – getragen von gegenseitigem Verständnis, klarer Kommunikation und gemeinsamer Verantwortung.
Digitalisierung ist vielmehr ein Mittel als ein Ziel. Sie kann helfen, Lernen individueller, zeitgemäßer und barrierefreier zu gestalten. Aber sie ersetzt nicht das Gespräch, nicht die gemeinsame Auseinandersetzung, nicht die Spannung des unmittelbaren Lernens. Bildung bleibt ein kultureller Prozess – und dieser lebt von Beziehungen, Erfahrungen und Sinnerfassung.
In einer Zeit, in der Algorithmen Alltagsrealitäten formen, kommt Schulen eine entscheidende Aufgabe zu: Kinder und Jugendliche nicht nur technisch zu befähigen, sondern sie schrittweise und altersgerecht in die Lage zu versetzen, die digitale Welt zu verstehen – und in ihr Verantwortung zu übernehmen. Die Vermittlung fortgeschrittener Medienkompetenz wird dabei zu einem zentralen Bildungsauftrag im digitalen Zeitalter.
Im Text genannte Quellen:
- BR24 (2024) – „Bayern setzt bei Digitalisierung auf späteren Start“
- Augsburger Allgemeine (2023) – Interview mit Klaus Zierer: „Professor kritisiert Tablets an Grundschulen“
- BLLV (2024) – Presse- und Fachveröffentlichungen zu Digitalisierung in Grundschulen
- AP News (2023) – „Sweden backtracks on digital learning in schools“